Thomas Oláh - Doppler
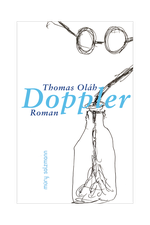
Mit einem Theaterknall beginnt dieser Roman, der über mehr als einen doppelten Boden verfügt. Er führt rasant in das fiktive österreichische Dorf Frankenhayn, ins Weinland, wo man den guten Tropfen gerne aus einer Zwei-Liter-Flasche, dem Doppler, trinkt. Doppelt sieht mancher dort, ein Herr diesen Namens kommt vor, und lebt man immer nur in einer Zeit??
Mit einem Autounfall setzt der Roman ein, bei diesem kommen Mutti und Vati ums Leben, nur der Erzähler des Romans überlebt. Er kommt zunächst auf eine Kinder-station: "Ich bin gestrandet, weiß nicht weiter und will nur weg. Was ich nicht ahne: dass dies das mich bestimmende Gefühlt bleiben sollte, für lange Zeit."
Sein Onkel holt ihn ab, bringt ihn zu den Großeltern, die von der ganzen Familie, auch den Enkeln, Mutter und Vater genannt werden.
"... ich bin aus allem hinausgeworfen, habe keine Verbindung mehr zur Welt."
Nun ist er also im "Exil", muss sich zurechtfinden in der Familie, die aus lauter ganz besonderen Mitgliedern besteht: der lachenden Tante, der hilflosen Tante, dem grausamen Onkel, den enthusiastischen Cousins Herla und Arla...
Die große Familie ist ein Abbild der Gesellschaft der 1970er.
Macht und Abhängigkeit, Gewalt, Doppelmoral, Frömmig-keit und Scheinheiligkeit, enttäuschte Hoffnungen, Lebens-weisheiten und immer wieder der Wein bestimmen das Leben. Vor allem der Wein: er ist so mächtig wie die Kirche, die beiden stehen sowieso in einer innigen Verbindung.
Thomas Oláh führt in die Welt der Kittelschürzen und sarg-artigen Betten, der ersten Selbstbedienungsläden, der Trennung von Männern und Frauen nicht nur in der Kirche, der Burschenweihe, der Mysteriosität des Weins und den Überbleibseln der Nazizeit ein. Außer den Kindern hat jeder diese noch erlebt, Spuren finden sich überall.
Er geht verschiedenen Typen des Dorfes nach: dem Metzger, der kommt, um die Sau zu schlachten. Die Schilderung des Schlachttags jagt einem das nackte Grauen über den Rücken, so roh geht es hier zu, wahrscheinlich ist diese Szene nur leicht überzeichnet.
Der Wirt kommt vor, der, wie seine dauerbetrunkenen Gäste, die auch in der Wirtschaft ihr Nickerchen machen, zu einer Karikatur geworden ist.
Der Postler, der täglich in jedes Haus kommt und alles sieht. Der Frisör, der die Köpfe in Form bringt, "jedenfalls äußer-lich, und darauf kommt´s an ..."
Die Ordnung ist ein Thema des Romans, überall sind neue Zeiten angebrochen, aber in Fankenhayn hängt man noch sehr den alten Anschauungen nach. Eine Lebensweisheit lautet:
"Mehr als aushalten ist nicht zu machen, nie. Wenn das gelingt, ist alles getan. Das gilt fürs Wetter wie fürs ganze Leben, im großen Ganzen ist nichts zu ändern, man versucht es, scheitert, versucht es wieder. Je früher man sich selber zugibt, dass nichts zu machen ist, und aufhört, sich zu wehren, desto leichter ist das Leben."
Die Kinder haben dies noch nicht so richtig begriffen. Allen voran die enthusiastischen Cousins, ein ganz besonders Doppel. Sie versuchen ständig, ihrem Vater, der sie oft mit Inbrunst durchprügelt, zu entkommen. Da sie nichts als Gewalt kennen, geben sie diese mit Enthusiasmus weiter, an Mensch und Tier.
Weil sie ungefähr im gleichen Alter sind, tut sich der Erzähler mit diesen Brüdern zusammen. Man plant und erlebt allerhand, z.B. wollen die Jungen fliehen, dazu muss ein Fluchttunnel gegraben werden. Man könnte einfach vom Hof spazieren... Sie "leihen" sich Fahrräder, versuchen den Traktor zu starten, wollen im Kofferraum des Direktors fliehen...
Allesamt unsinnig-aberwitzige Vorhaben, denen eine tiefe Tragik zugrunde liegt, wie dem ganzen Roman. Pausenlos bleibt einem das Lachen im Hals stecken, bricht der Boden weg, darunter sind dumpfer Sumpf und gärende Maische zu sehen.
Dies hängt nicht nur, aber auch, mit der Nazizeit zusammen, in diese führen die Erinnerungen Mutters und Vaters immer wieder. Vor allem zum 20. April 1945, dem Tag, an dem das "letzte Aufgebot" die Russen aufhalten sollte und auch Mutter aktiv in die Geschehnisse eingriff.
Drei Einschübe gibt es, sie haben auf den ersten Blick nichts mit der Handlung zu tun.
Im ersten geht es um ein "Chronometer der Momente", aus dem sich "Mälzels Metronom" entwickelt. Jeder Musiker kennt es.
Der zweite erzählt von dem Mathematiker und Physiker Christian Doppler, er entdeckte den "Doppler-Effekt". Zu dessen Beweis wurde eine Eisenbahn bemüht, es geht um Frequenzen und Laufzeiten.
Und der dritte Einschub handelt von einer ganz besonderen Brille, von Trotzki, Freud und Gödel. Und von einem Traum: der Erfindung eines "Chronometers der Gleichzeitigkeit".
Immer wieder also die Zeit, ihre Einteilung und individuelle Wahrnehmung.
Der Unfall kippte den Erzähler aus seiner Zeit: "Ich weiß, ich war auch schon vorher auf der Welt, aber es kommt mir vor, als wäre dies der erste Sommer meines Lebens gewesen. Mein erster Sommer." Er hat "keine Erinnerung mehr an das, was vor diesem Sommer war."
Thomas Oláh, geb. 1966, entwirft in seinem Debütroman scharf geschliffene Figuren, die er in eine realistisch und zugleich bizarre Szenerie stellt.
Gewalt, Alkohol, kein Wille zur Veränderung, die Krallen der katholischen Kirche sind die Grundzutaten, aus denen diese Welt besteht.
Doch der Roman ist bei weitem kein Trauerspiel, dafür sorgen der Ton und eine doppelbödige Erzählweise.
So gleicht beispielsweise das Herausziehen eines in den Doppler gedrückten Korkens einer Geburt, der Ablauf des Wein-Abfüllens einem Familienballett, in dem die Weinbauern ihre großen Nasen, die "Riesenreicher gut dienstlich einsetzen" können. Köstlich ist der Direktor, der allen Anstand vergisst, wenn es um Erdäpfelsalat geht.
Die Ordnung der Zeit, der Dinge, des menschlichen Lebens - selten war ein Nachdenken darüber so komisch, so tragisch, so, pardon, österreichisch-weinländisch.
Thomas Oláh: Doppler
Müry Salzmann Verlag, 2023, 224 Seiten
 Gute Literatur
Meine Empfehlung
Gute Literatur
Meine Empfehlung